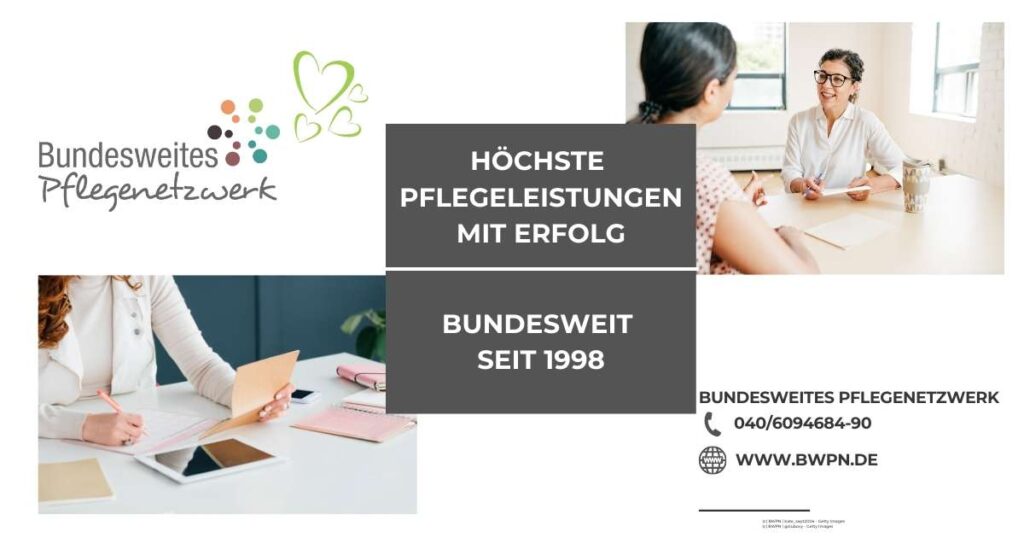Bestimmte (medizinische) Diagnosen in der Pflege gibt es nicht. Der Pflegegrad in Deutschland wird nicht nur auf Basis einer Diagnose festgestellt wird, sondern auf der Grundlage von Defiziten in der Selbstständigkeit bzw. in der Fähigkeit, alltägliche Dinge ohne Hilfe zu bewältigen. Pflegefachlich betrachtet spielen die Diagnosen in der Pflege sogar tendenziell eine untergeordnete Rolle.
Inhalt
Dennoch gibt es einige Krankheiten und Zustände, die häufig zu erhöhtem Pflegebedarf führen. Diese können sein:
- Demenz und andere degenerative Gehirnerkrankungen
- ADHS
- Schlaganfall
- Parkinson
- Multiple Sklerose
- Fortgeschrittene Herz-Kreislauferkrankungen
- Anorexia nervosa
- Fortgeschrittene Atemwegserkrankungen wie COPD
- Knochen- und Gelenkerkrankungen wie Rheuma oder Arthrose
- Alzheimer
- Arthrose
- Dysphagie
- MRSA
- Diabetes
- Angsstörungen
- Depressionen
- Krebs in fortgeschrittenen Stadien
- Schwere Psychische Erkrankungen
- Adipositas
- Arthritis
- ALS
- Fetale Alkoholspektrum-Störung (FASD)
- Epilepsie
- Fibromyalgie
Bei den oben genannten Erkrankungen handelt es sich nicht um Diagnosen in der Pflege im eigentlichen Sinn. Die benötigte Pflege hängt stark von der individuellen Situation, den vorhandenen Fähigkeiten und der Progression der Krankheit ab. Es kann Menschen mit den oben genannten Diagnosen geben, die einen relativ niedrigen Pflegebedarf haben, während andere Menschen mit denselben Diagnosen einen hohen Pflegebedarf haben können.
Diagnosen in der Pflege (Pflegediagnosen)
„Diagnosen in der Pflege“ beziehen sich üblicherweise auf Pflegediagnosen, die im Rahmen des Pflegeprozesses gestellt werden. Pflegediagnosen sind Einschätzungen durch professionelle Pflegekräfte, die gesundheitliche Probleme und Bedürfnisse von Patienten betreffen, die durch pflegerische Maßnahmen behoben, gelindert oder überwacht werden können. Pflegediagnosen unterscheiden sich von medizinischen Diagnosen. Während medizinische Diagnosen sich auf die Krankheit oder Störung (siehe oben) konzentrieren, die von Ärzten diagnostiziert und behandelt wird, beschäftigen sich Pflegediagnosen mit den Antworten der Menschen auf gesundheitliche Probleme und Lebensprozesse und den Fähigkeiten des Einzelnen zur Gesundheitsförderung.
Die Formulierung von Pflegediagnosen folgt üblicherweise einem standardisierten Format, welches drei Komponenten umfasst:
Problem: Hierbei wird das gesundheitliche Problem oder die menschliche Reaktion beschrieben, zum Beispiel „Schmerz“ oder „Beeinträchtigte Mobilität“.
Ätiologie/Ursache: Dieser Teil benennt die Ursache oder die Risikofaktoren für das Problem, wie etwa „nach operativem Eingriff“ oder „aufgrund von Bettlägerigkeit“.
Symptome/Zustandsmerkmale: Hier werden beobachtbare Anzeichen und Symptome oder Muster des Verhaltens benannt, die das vorgegebene Gesundheitsproblem belegen, beispielsweise „berichtet über Schmerzstufe 8 von 10“ oder „kann nicht selbstständig im Bett umpositionieren“.
Die Nutzung von Pflegediagnosen erlaubt es den Pflegekräften, den Pflegeprozess zu standardisieren und die Pflegeplanung, -durchführung und -evaluation zu strukturieren. Der Pflegeprozess ist dabei ein zirkulärer Ablauf, der mit der Einschätzung (Assessment) beginnt, gefolgt von der Diagnose, Planung, Umsetzung (Intervention) und Evaluation. Pflegediagnosen werden auch regelmäßig aktualisiert, um Veränderungen in Zustand und Bedürfnissen des Patienten Rechnung zu tragen. Pflegediagnosen sind ein wichtiges Werkzeug, um die Qualität der Pflege zu sichern und zu einer kontinuierlichen Verbesserung beizutragen. Sie sind zentraler Bestandteil der beruflichen Pflege und werden in der Ausbildung von Pflegefachpersonen umfassend gelehrt.

Bestens informiert:
Der BWPN-Pflege-Newsletter
Erfahren Sie alles über die verschiedenen zur Verfügung stehenden Leistungen, den optimalen Zeitpunkt für deren Beantragung und die aktuellen Änderungen. Mit dem BWPN-Pflege-Newsletter bleiben Ihnen keine dieser Informationen verborgen.